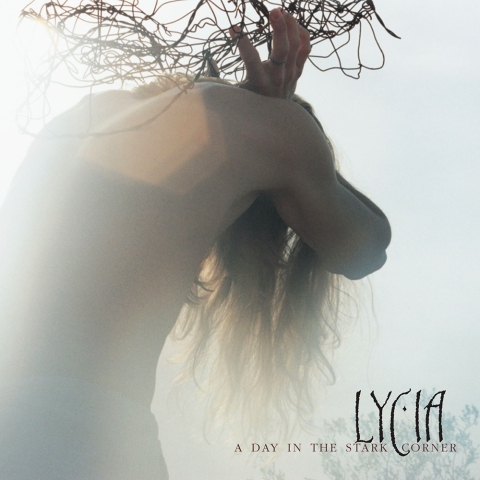Es gibt manchmal Momente in der Karriere eines Künstlers, die den Unterschied zwischen bloßer Nostalgie und echter kreativer Erneuerung markieren. Während viele seiner Zeitgenossen sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, tritt Gary Numan mit einem Werk hervor, das die Essenz seiner Vergangenheit bewahrt und dennoch eindrucksvoll im Hier und Jetzt verankert ist. „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ zeigt, wie ein Künstler, der die Geschichte der elektronischen Musik maßgeblich mitgeprägt hat, sich nicht nur neu erfinden, sondern auch tief in die düstere Welt seiner eigenen Emotionen eintauchen kann. Trotz ausgereifter, radiotauglicher Elektro-Pop-Nummern und starker Rock-Elemente fand das Album nicht die breite Anerkennung, die es verdient hätte.
Das Album beeindruckt durch eine dichte, sehr moderne Produktion, die Numans musikalische Entwicklung unterstreicht. Die Songs sind ausgefeilt und kraftvoll, verstärkt durch einen klaren, schweren Sound. Jeder Beat und jede Synthline wirken fast greifbar. Besonders auffällig ist, wie es Numan gelingt, eingängige Hits in einen elegischen Albumfluss einzubetten, ohne dabei den düsteren Grundton zu verlieren, der das gesamte Werk durchzieht. Die düsteren elektronischen Soundscapes sind nie Selbstzweck, sondern stets im Dienst der emotionalen Aussagekraft, die „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ vermittelt.
Von der ersten Sekunde an hüllt „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ den Hörer in eine dichte, apokalyptische Atmosphäre. Songs wie ‚I Am Dust‘ und ‚Love Hurt Bleed‘ lassen keinen Zweifel daran, dass Numan die klanglichen Grenzen auslotet, die er bereits in den 80er Jahren aufgezogen hat – nun jedoch mit einer Härte und Schwere, die enorm spürbar ist. Beeindruckend ist, wie er die elektronischen Arrangements mit kraftvollen, industriell angehauchten Rockelementen verbindet, ohne seine charakteristische Melancholie zu verlieren. „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ ist ein Album, das seine Wurzeln im Synthpop nicht verleugnet, aber durch die geschickte Fusion von Elektronik und Rock eine neue, finstere Tiefe erreicht.
Faszinierend ist auch, wie Numan seine Stimme einsetzt. Auch wenn sie nicht mehr so extravagant klingt wie in den späten Siebzigern und Achtzigern, passt sie perfekt zur melancholischen und düsteren Ausrichtung des Albums. Diese stimmliche Reife verleiht den Songs eine zusätzliche emotionale Ebene und macht deutlich, dass Numan auch im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere noch immer fähig ist, beeindruckende musikalische Statements abzugeben. Man hört deutlich, dass die Songs von einem Mann geschrieben wurden, der mit inneren Dämonen und existenzieller Unruhe kämpft. Seine stimmliche Darbietung auf „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ ist intensiver, reifer und verletzlicher als je zuvor. Titel wie ‚Here in the Black‘ und ‚The Calling‘ wirken wie dunkle Gebete, die zwischen Verzweiflung und Wut pendeln.
Trotz der dunklen, oft bedrückenden Themen strahlt das Album eine seltsame Hoffnung aus. In Songs wie ‚My Last Day‘ schimmert durch all die Dunkelheit und Melancholie ein Moment der Klarheit und Erlösung – ein letzter Blick auf die Sterne, bevor man in die Schwärze eintaucht. Es ist ein Album über inneren Zerfall, aber auch über den Überlebenswillen und die Kraft, die man aus den Ruinen ziehen kann.
Der Sound auf „Splinter (Songs from a Broken Mind)“ erinnert stark an den „Dark City“-Soundtrack, insbesondere an den Song ‚Dark‘, in dem Numan bereits 1998 die Blaupause für seine moderne Ausrichtung lieferte. Die Songs haben eine enorme Qualität, mit weiten, dröhnenden Klanglandschaften, die den Hörer unaufhaltsam in Numans dystopische Welt hineinziehen. Der „neue“ Numan klingt ernster, düsterer und kraftvoller als in seinen frühen Pionierzeiten, die zwar immer noch ihren Charme besitzen, aber in der heutigen Zeit etwas gezähmt wirken. Dieses Album zeigt, wie gut sich Numan in die moderne Musiklandschaft integriert hat, ohne seine Wurzeln zu verleugnen.
„Splinter (Songs from a Broken Mind)“ ist ein Beweis dafür, dass Gary Numan nicht nur eine Vergangenheit als Pionier der elektronischen Musik hat, sondern auch eine Gegenwart, die ihn als relevanten und kreativen Künstler zeigt. Sein Einfluss auf die moderne Musiklandschaft, insbesondere in den Bereichen Industrial und elektronischer Rock, ist nicht zu überhören. Es ist ein Album, das sowohl alte Fans als auch neue Hörer anspricht und das in seiner dunklen, kraftvollen Art tief beeindruckt. Der Nachfolger, der eigentlich fast noch besser ist, ist ebenfalls sehr empfehlenswert, wenn man mit diesem Stil etwas anfangen kann.

.jpg)