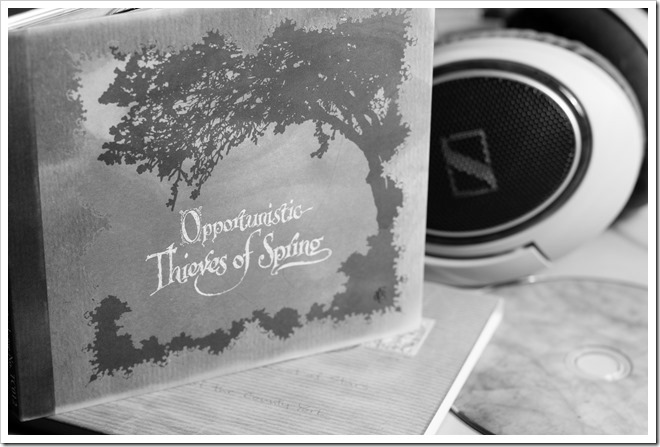Manchmal gibt es sie, die kleinen, versteckten Meisterwerke, die die Black-Metal-Szene auch heute noch erschüttern. Ein solch apokalyptischer Sturm und gleichzeitig Grenzen verschiebendes Meisterwerk ist „Salvation“ von der schwedischen Band Funeral Mist. Ein Black-Metal-Sturm voller Perversionen, Abartigkeiten, Hass und Macht! Musik, dunkler als eine Sonnenfinsternis und intensiver als jeder Höllenritt.
Schon der Beginn des Albums ist völlig faszinierend: brodelndes, industriales Wummern, Schreie, Kettengerassel, verzerrte Stimmen – bis der erste Song „Agnus Déi“ sehr leise beginnt. Es klingt irgendwie sehr leise produziert – also dreht man die Lautstärke höher. Was einen aber nach 12 Sekunden erwartet, ist der plötzliche Herztod für die Ohren: infernalisches Geschrei und megabrutales Drumming werden zusammen mit unglaublich bösartigen Riffsalven losgelassen. Bereits hier hatten mich Funeral Mist völlig gefangen genommen.
Vom ersten Ton an wird man von der überragenden Vokalakrobatik von Arioch überwältigt. Arioch bedient sich nicht des typischen Black-Metal-Gekreisches in eher höheren Tonlagen, sondern presst seine von Hass und Finsternis durchdrängten Texte in einer abartig tiefen Kehlkopf-Phrasierung in die Gehörgänge – völlig einzigartig und grandios lebendig. Er röhrt sich durch die zehn rabenschwarzen Songs, und der Wechsel zwischen tiefem Sprechgesang und garstigem Kreischen ist auf „Salvation“ an Perfektion kaum zu übertreffen.
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass Arioch das große Highlight auf „Salvation“ ist. Zudem ist seine Gesangsdarbietung in der gesamten Szene bis heute einzigartig!
Die Musik lebt jedoch auch von dem genialen Drumming, das fast durchweg rasend schnell dargeboten wird. Unerwartete Rhythmuswechsel, peitschende Grooveattacken und mörderisch gutes Timing prägen den Sound. Die Blastbeats werden immer wieder durch Breaks und kurze Samples aufgelockert – auch hier wird kein Standard geboten.
Ein weiteres Highlight ist die beängstigende Gitarrenarbeit von Arioch und Nachash. Riffs, die direkt aus dem Innersten der Hölle kommen, barbarisch und völlig frei von irgendwelchen Lebensspuren. Funeral Mist entfachen in den 65 Minuten einen unvergleichlichen apokalyptischen Sturm aus purem Hass, Zerstörung und Dunkelheit, der sich wie der vertonte Weltuntergang anhört. Jede der selten eingesetzten Melodien wirkt wie ein Triumphzug.
Filmsamples, Chöre, Mönchsgesänge – all das wurde auf „Salvation“ so intensiv in die Musik integriert, dass jeder Soundschnipsel perfekt platziert ist. Keine warmen Melodien, keine Spur von Ordnung oder Harmonie – der gesamte Sound von Funeral Mist ist ein abartiger, finsterer Strudel, ein schwarzes, unendliches Loch – pure hasserfüllte Energie!
Auch die Produktion von „Salvation“ ist perfekt in Szene gesetzt. Der Sound ist schon fast zu sauber und dennoch klingt alles lebendig, natürlich, roh und polternd. Eine perfekte Gratwanderung zwischen urwüchsiger Black-Metal-Tradition und musikalischer Größe.
Dass Arioch auch bei Marduk für die großen Momente sorgt, sollte mittlerweile bekannt sein. Musikalisch spielen Funeral Mist jedoch in einer eigenen Liga! Arioch gehört mit Sicherheit zu den großen Black-Metal-Künstlern, nicht nur wegen seines außergewöhnlichen Organs, sondern auch wegen seiner kompositorischen Klasse. Er ist nebenbei auch für das gesamte Songwriting bei Funeral Mist verantwortlich.
Nicht nur die Musik auf „Salvation“ ist ein alleiniges Highlight in der Black-Metal-Szene, auch das überragende Coverartwork mit seinen abartig kranken Details stellt fast jedes andere Black-Metal-Cover in den Schatten. Funeral Mist haben mit „Salvation“ nicht weniger als eines der intensivsten und herausragendsten Black-Metal-Werke des 21. Jahrhunderts erschaffen!
Donnerstag, 10. November 2011
Funeral Mist - Salvation
Mittwoch, 19. Oktober 2011
Urfaust - Geist ist Teufel
„Geist ist Teufel“ darf mit Sicherheit heute schon zu den schillerndsten Veröffentlichungen des „neuen“ Black Metal gezählt werden. Aber ist „Geist ist Teufel“ überhaupt noch Black Metal? Wie weit sind die Grenzen? Urfaust lassen sich jedenfalls auch heute noch nicht kategorisieren oder in irgendeine Schublade stecken. Die Musik der Holländer ist eine komplett unwirkliche Fahrt durch Sphären, die man gewillt sein muss zu betreten.
Dabei machen es einem die Holländer nicht leicht, sich in ihrer Musik zurechtzufinden. Proberaum-Sound, bewusst belassene Spielfehler, überlange Songs und massenweise fremde Einflüsse – dazu ein Gesang, der zwischen purem Wahnsinn und betörender, hypnotischer Kraft hin und her pendelt. Der Gitarrensound ist fast schon an der Grenze zur Unhörbarkeit reduziert: mächtig kratzig und rostig. Melodien, die es massenweise auf „Geist ist Teufel“ zu entdecken gibt, bleiben dem Hörer zunächst verschlossen.
Das Album wird von einem stimmungsvollen Intro eröffnet. Ein eigenwilliger Tenor, beinahe beängstigend, von IX macht gleich von der ersten Sekunde an klar: Love it or hate it! Ambient-Klänge, dunkle Töne, wabernde Schwingungen – völlig reduziert und auf eine ganz eigenwillige Weise faszinierend. Eine geistige Spannung baut sich auf, bevor man durch den ersten Song „Die kalte Teufelsfaust“ die Hässlichkeit in Ton und Schmerz erlebt – zumindest vorerst.
Primitiv, völlig abwesend und ohne Sound-Perfektion poltern und holpern sich Urfaust durch ganze sechs Minuten reinster Reduziertheit. Was soll das sein? Undefinierbare Riffs, katastrophales Drumming, ein Sound, der mehr als nach Keller stinkt, und dieser irre Psychopathengesang – wechselnd zwischen extremem Kreischen à la Burzum und opernhaftem Klargesang mit einer wirklich ganz eigenen Note.
Bereits hier spalten sich die Meinungen: Wollen Urfaust überhaupt Black Metal sein? Ist dieser völlig geisteskranke Chaotenhaufen es überhaupt wert, sich weiter mit ihrer Musik zu beschäftigen? Die Antwort lautet: Ja – und noch viel mehr als das! Urfaust haben nach anfänglichen Berührungsängsten etwas völlig Einzigartiges erschaffen. Sie haben sich ein eigenes Genre geformt und sich zu einer der hypnotischsten Black-Metal-Bands entwickelt, die die Szene jemals hervorgebracht hat.
Urfaust sind mehr als nur eine Black-Metal-Band: Urfaust stehen für Spiritualität, für Kunst in ihrer hässlichsten Form, für pure Magie. Rabiat und ungehobelt, musikalisch so undefinierbar wie keine andere Black-Metal-Band. Die innere Schönheit ihrer Musik wird nicht jeden erreichen – und das ist sicher auch so beabsichtigt. Diese Musik funktioniert nur, wenn man sich komplett in sie fallen lassen kann.
Urfaust ist eine der wenigen Bands, die wirklich auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn Musik erschaffen. Musik, die äußerlich abstoßend und hässlich ist, die aber erkämpft werden muss, um die wahre Magie des Urfaust-Sounds zu erkennen. Zähflüssig baut jeder Song eine unbeschreibliche Stimmung auf – krank und faszinierend zugleich, als hätten sich Urfaust im Tonstudio verirrt und wären mit ihren Instrumenten direkt in der Klapsmühle gelandet.
Wie viele beneidenswerte Songs Urfaust geschrieben haben, ist ebenfalls in der Black-Metal-Szene einzigartig. Ob man nun die vielen Split-Veröffentlichungen, die EPs oder die drei regulären Alben „Geist ist Teufel“, „Verräterischer, Nichtswürdiger Geist“ (2005) oder das aktuelle Meisterwerk „Der freiwillige Bettler“ (2010) betrachtet – jede einzelne Veröffentlichung enthält mehr als Black Metal. Ihre Musik geht weit über die Grenzen hinaus und erschafft etwas völlig Eigenartiges.
Es ist schwer, den Sound von Urfaust zu beschreiben, geschweige denn ihn mit anderen Bands zu vergleichen. Ich kann nur sagen, dass Urfaust für mich die interessanteste aller derzeitigen Black-Metal-Bands ist. Menschen mit schwachen Nerven und Schöngeister sollten allerdings einen großen Bogen um die Holländer machen!
Samstag, 15. Oktober 2011
Marduk - Those Of The Unlight
Schwedens bekannteste und vielleicht auch legendärste Black-Metal-Band Marduk spielte zu Beginn ihrer Karriere kantigen Death Metal, den man bereits auf dem 1991 veröffentlichten Demo „Fuck Me Jesus“ mit fanatischer Hingabe zelebrierte. Das ein Jahr später erschienene Debüt „Dark Endless“ gehört, wie auch Darkthrones erstes Album „Soulside Journey“ (1991), zu den leider wenig beachteten Death-Metal-Alben aus Skandinavien. Beide Alben besitzen eine fantastische schwarze Aura und sind mit einer grandiosen Old-School-Produktion ausgestattet (Tomas Skogsberg war für „Soulside Journey“ verantwortlich und Dan Swanö für „Dark Endless“).
Warum diese beiden Alben in der Geschichte des Death Metal fast immer übergangen werden, bleibt bis heute ein Rätsel.
1993 erschien, nach einigen Besetzungswechseln, das für viele bis heute beste Marduk-Album „Those of the Unlight“, auf dem die Band ruppigen Death Metal mit rasendem Black Metal und jeder Menge erstklassiger Melodien kombinierte. Von der typischen Monotonie und den einschläfernden Knüppelorgien, für die Marduk spätestens mit dem Einstieg von Legion am Gesang auf „Heaven Shall Burn... When We Are Gathered“ 1996 „bekannt“ wurden, ist bis einschließlich des „Opus Nocturne“-Albums von 1994 nichts zu spüren.
Marduk waren bis zum Einstieg von Legion eine eigenständige, hochklassige Black-Metal-Band, die sich auch nicht völlig schwedischen Melodien verweigerte. Auf „Those of the Unlight“ schafften Marduk meiner Meinung nach den besten Spagat zwischen Black Metal und Death Metal und würzten ihre Songs mit fantastischen Melodien. Auch hier war wieder Dan Swanö, diesmal zusammen mit Marduk, für den Sound mitverantwortlich. Der typische frühe Marduk-Sound – natürlich, lebendig, mit viel Hall und jeder Menge Raum für Atmosphäre – war noch weit entfernt von Peter Tägtgrens klinisch toten Produktionen der späteren Marduk-Alben.
Die Songs wirken lebendig, zügellos und doch gebündelt, rau und trotzdem warm. Besonders mit dem sieben Minuten langen Instrumentalstück „Echoes from the Past“ haben Marduk ein ganz besonderes Stück Musik auf dem Album hinterlassen. Ambientartige Klänge, beruhigende Töne und eine große Melodie lassen Marduk für sieben Minuten das komplette Black-Metal-Universum verlassen und tauchen den Hörer in eine tranceartige Gedankenreise. Dem gegenüber stehen Black-Metal-Klassiker wie „Burn My Coffin“, „Wolves“ oder der Titeltrack, die alle mörderische Hooklines besitzen und mit ausgefeilten Rhythmuswechseln begeistern.
Das Drumming von Af Gravf ist zwar nicht so brachial produziert wie das von Fredrik Andersson, besticht jedoch durch mehr Abwechslung und eine stärkere Death-Metal-Schlagseite. Richtig geknüppelt wird eigentlich selten. Auf „Those of the Unlight“ spielen Marduk geschickt mit Melodien, Tempowechseln und einprägsamen Gitarrenriffs. Dabei wird natürlich im hohen Tempo musiziert, von banalen Knüppelorgien der späteren Werke ist man jedoch meilenweit entfernt.
Zusätzlich schaffen Marduk nur auf „Those of the Unlight“ eine ganz spezielle Atmosphäre, die sie auf keinem weiteren Album mehr einfangen konnten. Vielleicht lässt sich das so erklären: „Dark Endless“ bot lupenreinen, schwarzen Death Metal, und „Opus Nocturne“ lupenreinen Black Metal – dazwischen liegt „Those of the Unlight“, das sich bei beiden Elementen bedient. Auch der Gesamtsound von „Those of the Unlight“ erinnert mich stellenweise an Dissections kongeniales Meisterwerk „The Somberlain“, das ein Jahr später erschien und einen fast identischen Sound aufweist.
Leider schafften Marduk es danach nur noch mit dem Nachfolger „Opus Nocturne“, die einstige Qualität, für die die Band am Anfang stand, zu erreichen. Alben wie „Nightwing“ (1998), „Heaven Shall Burn... When We Are Gathered“ (1996) oder „Panzer Division Marduk“ (1999) sind an Langeweile in der Black-Metal-Szene bis heute ungeschlagen. Ausdrucksloses Gekreische, einschläferndes Drumming und immer wieder dasselbe Gitarrenriff, kombiniert mit Tägtgrens zum Haare raufenden, klinisch toten Overlook-Sound, machten Marduk für mich unhörbar, und die Band selbst wurde immer weiter in den Strudel der Lächerlichkeit und Peinlichkeiten gezogen.
Eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so drastische Entwicklung konnte man auch bei den norwegischen Black-Metal-Legenden Immortal und Satyricon beobachten. Den jüngeren Fans gefiel der neue Marduk-Sound, und so gehören Marduk auch heute noch zu den wohl bekanntesten Black-Metal-Bands der gesamten Szene. Die kreative Hochphase der Band wird jedoch mit völliger Nichtbeachtung gestraft, sodass Alben wie „Panzer Division Marduk“ oder „World Funeral“ als die Highlights von Marduk gelten.
Ironischerweise wandten sich viele jüngere Fans von der Band ab, als endlich Legion die Band verließ und auch Fredrik Andersson die Sticks an den Nagel hängte. Dass man mit dem neuen Drummer Emil Dragutinovic und besonders mit Sänger Mortuus (kreativer Kopf hinter den grandiosen Funeral Mist) zwei absolute Talente und Ausnahmekönner der Szene gewinnen konnte, interessierte auf einmal nicht mehr. Die Alben „Plague Angel“ (2004) und „Rom 5:12“ (2007) boten wieder lebendigeren Black Metal, der näher an den ersten Alben war, und glänzten mit den besten Gesangsleistungen aller Marduk-Alben.
Aus persönlicher Sicht ziehe ich zwar immer noch das Debüt „Dark Endless“ vor, dennoch ist „Those of the Unlight“ das bis heute prägendste und kompletteste aller Marduk-Alben.
Dienstag, 4. Oktober 2011
Inquisition - Into the Infernal Regions of the Ancient Cult
Zwischen 1997 und 1999 wurde die nicht mehr so undergroundige Black-Metal-Szene durch unaushaltbar kitschige Keyboard- und Symphonic-„Black“-Metal-Alben regelrecht überschwemmt. Black Metal wurde zum Massenprodukt – überall wurden Anzeigen geschaltet und jede Menge Werbung gemacht, bis hin zum obligatorischen Video-Clip. In jedem Metal-Magazin räumte man den neuen Bands immer mehr Platz ein. Fast alles, was aus Skandinavien bzw. aus Norwegen kam, wurde mit hohen Noten bewertet, während die Vorreiter-Bands der zweiten Black-Metal-Welle immer weniger Beachtung fanden.
Alles, was ekelhaft klebrig süß, angepasst, glattpoliert und bloß nicht provozierend war, wurde abgefeiert. Bands wie Catamenia, Mystic Circle, Agathodaimon, Dimmu Borgir, Cradle of Filth, Covenant, Bal-Sagoth, Siebenbürgen und Old Man’s Child, um nur die Spitze des Eisbergs zu nennen, waren die neuen Helden und Aushängeschilder dieser Szene. Innerhalb von ein paar Monaten wurde der komplette Mythos der zweiten Black-Metal-Welle von einer bunten Gummibärenbande-Welt weggeschwemmt!
Bands wie Enslaved (Eld, 1997 / Blodhemn, 1998), Darkthrone (Ravishing Grimness, 1999), Gorgoroth (Under the Sign of Hell, 1997), Mayhem (Wolf’s Lair Abyss, 1997), Arcturus (La Masquerade Infernale, 1997) oder Bethlehem (Sardonischer Untergang im Zeichen irreligiöser Darbietung, 1998) wurden in den Metal-Magazinen belächelt und wegen angeblichem Stillstand, mangelnden Melodien und fehlender glattpolierter Produktion kritisiert.
Inmitten dieser Zeitepoche von hirnlosen Kasperproduktionen und angepasstem Teenie-Mädchen-Romantic-Vampir-Gothic-Rosen-Samt-Ekelterror, zündete eine völlig unbekannte kolumbianische Band namens Inquisition die Black-Metal-Wasserstoffbombe. „Into the Infernal Regions of the Ancient Cult“ ist vielleicht das wichtigste Black-Metal-Album der ausklingenden 90er Jahre! Ein Manifest des traditionellen Black Metal, eine Lobpreisung und Huldigung an eine fast untergegangene Szene – die letzte Aufbäumung gegen die Gummibärentrolle und Vampir-Chicks weltweit.
„Into the Infernal Regions of the Ancient Cult“ ist mehr als nur ein Black-Metal-Album – es ist Lebensgefühl, dunkles Elixier und okkulte Kraft. Inquisition haben mit diesem Album den lang ersehnten „Retter“ der Szene geschaffen, ein Werk, das während seiner gesamten Spielzeit gegen den Strich bürstet und in seiner Unangepasstheit und „Kauzigkeit“ weltweit im Underground für einen Siegeszug sorgte.
Die Medien bekamen von dieser Band natürlich gar nichts mit. Später bespuckte man die beiden Kolumbianer mit hilflosen Argumenten und fadenscheinigen Aussagen. Inquisition tourten durch kleine Clubs und avancierten besonders in Deutschland für längere Zeit zur Black-Metal-Band schlechthin.
Inquisition haben sich einen völlig eigenen Sound geschaffen: ungewöhnlich tief gestimmte Gitarren und ein knackiger, natürlicher Drumsound sorgen für einen auf der einen Seite sehr dünnen, aber auch sehr druckvollen Klang. Live verzichten Inquisition komplett auf den Bass, den man auf den Alben ohnehin kaum wahrnimmt – dieser wird durch den ungewöhnlichen Gitarrensound ausgeglichen.
Schon rein instrumental haben sich Inquisition einen eigenen Stil erschaffen, doch da wäre ja noch der Gesang von Dagon. Ein fieser, giftiger Teufelsfrosch aus den kolumbianischen Urwäldern mit Kehlkopfkrebs im Endstadium – so könnte man die Laute von Dagon einigermaßen beschreiben. Völlig einzigartig, völlig kauzig, für viele abschreckend und belustigend, aber eigentlich völlig geil und betörend.
Alle zehn Songs sind kleine Meisterwerke des Black Metal. Unglaublich abwechslungsreich komponiert und bei aller Liebe zum Old-School-Sound mächtig atmosphärisch und melodiereich. Die Tempowechsel werden geschickt eingesetzt, Rasereien mit doomigen Passagen und leicht folklorischen Einflüssen kombiniert. Inquisition halten die gesamten 66:06 Minuten die Spannung aufrecht, kombinieren tonnenschwere Doom-Riffs mit bezaubernden Melodien, rasende Blastbeats mit unerwarteten Breaks und Rhythmuswechseln.
Erstaunlich ist, dass diese Band schon seit 1988 im Underground wütet und bis heute eigentlich kein schwaches Album veröffentlicht hat. Die persönliche Bedeutung und auch die Bedeutung für die Black-Metal-Szene Ende der 90er Jahre sind jedoch besonders auf „Into the Infernal Regions of the Ancient Cult“ einzigartig geblieben.
„Into the Infernal Regions of the Ancient Cult“ ist für die Black-Metal-Szene mindestens genauso wichtig wie „Drachenblut“ und „Blacken the Angel“ für den Einhorn-Pink-Metal.
Hail The Cult!
Montag, 26. September 2011
Cobalt - Eater Of Birds
Technisch gesehen ist das gesamte Album absolute Speerspitze. Hirnfickende Gitarrenriffs, die sich tief durch die Nervenbahnen fräsen, ein unglaublich tightes und zugleich mördermäßiges Drumming und eine rostige Kehlkopfstimme sorgten 2007 für ein absolutes Highlight in der weltweiten Black-Metal-Szene.
Der Sound ist voluminös, aber natürlich, und trotzdem extrem roh. Er bietet großen Freiraum für die brillanten Gitarrenriffs. Drückend und unbarmherzig sägen die Black-Metal-untypischen Riffs über einen hinweg. Ein unbeschreiblicher Sturm aus harmonischen Melodien und gnadenlosen, fast schon thrashigen Riffsalven wird im Sekundentakt abgefeuert. Zwischendurch werden die überdurchschnittlich langen Songs immer wieder durch fantastische Breaks, Grooveattacken und orientalische Melodien aufgerüttelt.
Allein diese ungewöhnliche Gitarrenarbeit auf „Eater Of Birds“ stellt ein absolutes Erkennungsmerkmal dieser grandiosen amerikanischen Black-Metal-Band dar. Nicht nur die einzigartigen Gitarrenriffs machen „Eater Of Birds“ zu einem Szenenhighlight; die gesamten Songs bilden eine so dichte Einheit, dass Akustikgitarren und orkanartige Riffs nahtlos verschmelzen. Das Songwriting geht dabei eigentlich schon weit über die eigentliche Black-Metal-Kunst hinaus.
Neben den wuchtigen Riffs ist besonders das Drumming auf „Eater Of Birds“ eine absolute Meisterleistung. Wie tight und abwechslungsreich, zugleich unglaublich songdienlich, wird hier geprügelt, gegroovt und gerockt – und das alles auf einem technischen Niveau, das weit entfernt vom üblichen Black-Metal-Drumming ist. Es macht einfach nur Spaß, jeden einzelnen Schlag von Erik Wunder zu verfolgen, sich auf den bevorstehenden Taktwechsel zu freuen, die Dynamik und den Groove zu bestaunen, während man von den irren sägenden Riffs begleitet wird – oder umgekehrt.
Da stört es auch nicht, dass kaum bis gar kein Bassspiel zu vernehmen ist. Wie intensiv Cobalt diese beiden Instrumente auf dem Album zusammenschweißen, ist in meinen Ohren völlig einzigartig im Black Metal! Songs wie „Ulcerism“, „Invincible Sun“, „Witherer“ oder der Showdown „Eater Of Birds“ wären von einer europäischen Black-Metal-Band niemals auch nur ansatzweise zustande gebracht worden.
Cobalt verarbeiten sicherlich jede Menge genrefremde Einflüsse (Sludge, Doom, Thrash, Hardcore), aber im tiefsten Kern sind sie schwärzer und beängstigender als viele der skandinavischen Black-Metal-Bands. Spielerisch kommen nur wenige Bands an Cobalt heran. Das gesamte Sounddesign auf „Eater Of Birds“ ist so beeindruckend und ergreifend. Die Gitarren könnten nicht drückender produziert sein, und das Drumming ist so fesselnd und mitreißend, dass man es in diesem Ausmaß höchstens noch bei Absu oder Mayhem bestaunen kann.
Cobalt haben sich fast schon einen eigenen Sound erschaffen, der weit über die geltenden Black-Metal-Standards hinausgeht. Damit haben sie sich an die Speerspitze des USBM gespielt. Neben Bands wie Woe, Krallice, Wolves In The Throne Room, Absu und neueren Acts wie Ash Borer, Liturgy, Castevet, Fell Voices und vielen weiteren spannenden Bands gehören Cobalt zu einer fantastischen und eigenständigen Black-Metal-Szene, die fernab europäischer Traditionen völlig eigenständige Werke hervorbringt. In Sachen Kunst und Underground hat diese Szene die vor sich hindümpelnde skandinavische Szene längst abgehängt.
So oder so, Cobalt haben mit „Eater Of Birds“ und dem nicht weniger herausragenden Nachfolger „Gin“ ein absolutes Meisterwerk des USBM erschaffen!
Mittwoch, 7. September 2011
Napalm Death - Utopia Banished
Napalm Death gehören zu den großen Legenden im Death Metal, Mitbegründern des Grindcore und Urgesteinen des Death Metal, die eigentlich kein schwaches Album abgeliefert haben. Mit „Scum“ und „From Enslavement to Obliteration” erschufen sie in den Achtzigern zwei der größten Grindcore-Meilensteine, die bis heute einflussreich sind.
Richtig „interessant“ wurden Napalm Death für mich allerdings erst mit dem Einstieg des sympathischen Mark "Barney" Greenway, der von Benediction kam. „Harmony Corruption“ war das erste Album mit Barney am Mikro und klang mehr nach Death Metal als nach „wüsten“ Grindcoreausbrüchen, obwohl diese weiterhin einen großen Teil des Napalm Death-Sounds ausmachten.
Einen großen Anteil am Death-Metal-Sound hatte auch Produzent Scott Burns, der „Harmony Corruption“ im Morrisound Studio einen guten, aber meiner Meinung nach nicht ganz passenden Sound für Napalm Death verpasste. „Suffer The Children“ ist bis heute ein Klassiker des Death Metal, und dieser Song von „Harmony Corruption“ ist nicht der einzige in der langen Bandgeschichte, der es zum Klassiker geschafft hat.
1992 tauchte „Utopia Banished“ in der Szene auf, das viele bis heute als das beste Werk von Napalm Death ansehen. Ich finde, Napalm Death haben vielleicht nur noch auf dem völlig unterbewerteten „Enemy of the Music Business“ so ausgeglichen und brachial geklungen. Einen großen Anteil an der barbarischen Zerstörungskraft von „Utopia Banished“ hatte auch Produzent Colin Richardson, der diesem Meisterwerk einen saftigen und gleichzeitig brutal-drückenden Sound verlieh.
Die Gitarren von Jesse Pintado und Mitch Harris sägen gnadenlos zum wütenden Drumming von Danny Herrera, der seine wahnwitzigen Blastbeats mit nur einem Pedal runterrotzt – eine absolute Seltenheit bei den aktuellen Drummern in der Extrem-Metal-Liga. Über Shane Embury muss man wohl kaum etwas sagen: eine der kultigsten Figuren in der gesamten Death-Metal-Szene, der jedes Soundloch mit seinem knurrenden Bass füllt.
Und dann wäre da noch einer der wichtigsten, einflussreichsten und intelligentesten Frontmänner der Death-Metal-Szene: Mark "Barney" Greenway. Er ist und bleibt die coolste Sau der Szene und lässt auf der Bühne 99 % der Konkurrenz alt aussehen. Irgendetwas aus dem Kleiderschrank gekramt, egal, ob es nun passend ist oder nicht – auf die Bühne, um mit purer Leistung zu überzeugen. Dazu feuert er zwischendurch immens wahre und teilweise wichtige Statements ins Publikum, anstatt die millionste ausgeleierte Tod-, Teufel- und Splatterphrase zu blöken. Viel zu selten kann man so etwas beobachten.
Nebenbei ist Barneys Stimme einzigartig und sofort herauszuhören. Auf „Utopia Banished“ klang sie das erste Mal typisch Barney-like – ebenfalls eine Seltenheit in der heutigen Zeit. Gottsongs wie „I Abstain“, „Dementia Access”, „The World Keeps Turning” oder „Upward and Uninterested” bilden das Fundament dieses Klassikers des Death Metal, das bis heute nichts von seiner Durchschlagskraft verloren hat.
Samstag, 3. September 2011
Fleurety - Min Tid Skal Komme
Neben Ved Buens Ende, Arcturus, In The Woods und Solefald gehören Fleurety aus Norwegen zu den frühen Vertretern des avantgardistischen, progressiven Black Metal der Mitte der 1990er Jahre. Nach dem 1993er-Demo „Black Snow“ und der höllisch intensiven EP „A Darker Shade of Evil“ aus dem Jahr 1994, erschien 1995 mit „Min Tid Skal Komme“ eines der bis heute bedeutendsten und anspruchsvollsten Black-Metal-Werke aus Norwegen.
Noch vor Ved Buens Endes Meisterwerk „Written In Waters“ formten Fleurety auf ihrem Debüt avantgardistischen Black Metal mit einer starken progressiven Note. Die Musik dieser beiden Norweger lässt sich nur sehr schwer in Worte fassen. Während auf der EP „A Darker Shade of Evil“ noch eigenwilliger Black Metal mit extrem geistesgestörtem Kreischgesang zu hören war, überraschten die Norweger auf „Min Tid Skal Komme“ mit ungewöhnlichen Songstrukturen und eigenwilligen Ideen.
Der 70er-Jahre-Progressive-Rock sickerte aus jedem der fünf Songs, und die eigenartige Rhythmik dieser 45 Minuten gehörte damals zu den abgefahrendsten Entwicklungen im Black Metal. Heute gibt es technisch und songwriterisch anspruchsvollere Alben im Black Metal, aber 1995 waren Fleurety mit ihrem Debüt eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der Szene.
Besonders hervorzuheben ist der dominante Bass-Sound, der einer kleinen Innovation im ansonsten eher höhenlastigen Sound nahekam. Das Gleiche gilt für den ungewöhnlichen Frauengesang von Marian Aas Hansen, der zur damaligen Zeit einzigartig in der Szene war. Die Gitarrenarbeit ist schroff, schräg, aber zugleich melodisch und fordernd. Die irrwitzigen Basslinien disharmonieren fantastisch mit den ohnehin schon sehr schrägen Riffs, und die Breaks und Tempowechsel erzeugen eine Atmosphäre, die den Hörer hin- und herreißt.
„Fragmenter Av En Fortid“ eröffnet das Album mit ruhigen Tönen: Die Gitarre surrt ein hypnotisches Riff, der Bass röhrt rhythmisch dazu, alles steigert sich zu einem harmonischen Teil, bis nach fast vier Minuten verrückte Riffs, treibendes Schlagzeug und der finstere Kreischgesang einsetzen. Melodie, Harmonie, Disharmonie, Breaks, Tempowechsel, Frauengesang und psychopathisches Gekreische – allein wie geschickt diese ersten neuneinhalb Minuten des Albums aufgebaut sind, ist die reinste schwarzmetallische Offenbarung.
Doch dies ist nur der Anfang eines großartigen Albums. Mit „En Skikkelse I Horisonten“ folgt ein schwarzes Psychogramm – die vertonte Abfahrt durch abstrakte Dimensionen. Trister Frauengesang und aufrüttelnde Harmonien treffen auf ätherischen Black Metal und schwarze Leidenschaft, gefolgt von progressivem Kauderwelsch und disharmonischen Klangskulpturen. Alles ist so schräg und außerhalb der Norm, und dennoch strahlt der gesamte Song eine unbeschreibliche Schönheit aus.
„Hvileløs?“, fast durchweg instrumental, erinnert mit seinen pompösen Keyboards anfänglich an Arcturus, kontert jedoch bereits nach anderthalb Minuten wieder mit synapsensprengenden Arrangements, beißenden Gitarrenriffs und verstörender Laut-Leise-Dynamik. Auch „Englers Piler Har Ingen Brodd“ glänzt mit grandiosem Frauengesang, psychedelischen Riffs, leichten Keyboardflächen und einer gespenstischen Atmosphäre.
Auf „Min Tid Skal Komme“ ist jeder Song ein kleines Kunstwerk. Beängstigend abwechslungsreich und gesegnet mit unerschöpflichen Sound- und Songideen. Das abschließende „Fragmenter Av En Fremtid“ ist genauso ungewöhnlich wie das gesamte Album. Ruhige, leicht jazzige Momente, veredelt durch Marian Aas Hansens wunderbaren Gesang, lassen dieses Kunstwerk leise ausklingen.
Bis heute ist mir kein weiteres Album im Black Metal bekannt, das eine solche Ausstrahlungskraft besitzt, komplizierte, aber dennoch harmonische Songs bietet und gleichzeitig „revolutionär“ klingt. „Min Tid Skal Komme“ war 1995 ein genresprengendes Kunstwerk, klingt nahezu zeitlos für Black-Metal-Verhältnisse und ist eines der Vorreiterwerke des heute so häufig zitierten Post-Black Metal.
Dienstag, 30. August 2011
Wolves In The Throne Room - Two Hunters
Schon das begnadete Vorgängerwerk „Diadem Of 12 Stars“, das ein Jahr zuvor erschien, sorgte für jede Menge Begeisterung im Black-Metal-Underground. Ursprünglicher Black Metal amerikanischer Prägung, kombiniert mit einer Vielfalt an ungewöhnlichen Melodien und einer sagenhaften Atmosphäre, wurde von den drei eigenartigen Amerikanern erschaffen. Raserei gepaart mit dichten Harmonien und spannenden Songs, die alle eine Spielzeit von über 10 Minuten aufwiesen.
Das ein Jahr später erschienene Nachfolgerwerk „Two Hunters“ konzentrierte sich auf die Stärken des Vorgängers, erreichte ein noch ergreifenderes Songwriting, bot noch mehr Gänsehautmelodien und avancierte mit gerade einmal drei Songs zu einem der besten Black-Metal-Werke des Jahres 2007!
Was genau macht „Two Hunters“ so besonders? Was unterscheidet dieses Werk von den restlichen europäischen Black-Metal-Veröffentlichungen? Zuerst sind da die Songs: Alle drei Kompositionen sind ungreifbare Diamanten von schwärzester Schönheit und zugleich brutal, ungestüm und fordernd.
Eingeleitet wird das Album durch das ungewöhnliche „Dea Artio“, ein sehr ruhiges und tragendes Ambient-Stück, begleitet von seichten Drumschlägen, atmosphärischen Keyboards und spacigen Gitarrentönen. Dieses Stück erinnert eher an düsteren Post-Rock. Doch schon mit dem folgenden „Vastness And Sorrow“ stürmt die Band in Sphären, die nur wenige Black-Metal-Bands erreichen. Eine klagende Gitarre beginnt, bis das überragend erdige und natürlich klingende Schlagzeug einsetzt.
Harmonische Riffs erzeugen von der ersten Sekunde an diese typische, einzigartige Atmosphäre, die Wolves In The Throne Room auszeichnet. Traumhafte Melodien werden im Minutentakt mit der Gitarre erzeugt, rasende Drumsalven legen sich wie kalte Nebelwände über den gesamten Song, und der kräftige Gesang von Nathan und Rick thront über diesem unfassbar stimmigen Klanggemälde. Allein mit diesen 12 Minuten erzeugen Wolves In The Throne Room eine Atmosphäre, die bei skandinavischen Black-Metal-Bands kaum vorstellbar ist.
Auch das ungewöhnliche Drumming, das nicht einfach nur drauflosknüppelt, trägt maßgeblich zu dem kulinarischen Songwriting bei. „Cleansing“, ebenfalls sehr ruhig beginnend und mit Frauengesang untermalt, erinnert anfänglich eher an Dead Can Dance als an Black Metal. Genau diese kleinen stilistischen Merkmale unterscheiden den amerikanischen Sound von der eher eisigeren und roheren europäischen Spielart des Black Metal.
Nach vier tranceartigen Minuten beginnt der Song genauso stürmisch wie „Vastness And Sorrow“ und spart ebenfalls nicht mit hintergründigen Melodien. Der absolute Höhepunkt des Albums folgt jedoch mit dem Kernstück „I Will Lay Down My Bones Among The Rocks And Roots“, einem der besten Black-Metal-Songs der letzten Jahre! Was hier für ein abwechslungsreiches Gewitter geboten wird, welche Harmonien sich in diesem Klangkosmos offenbaren und wie überragend die Band mit Melodien arbeitet – das alles geht meilenweit über den üblichen Black Metal hinaus.
Die gesamten 18 Minuten erzeugen eine Atmosphäre, die man nicht weniger als einzigartig beschreiben kann. Ein Monument, das Black Metal auf einer ganz anderen Ebene zelebriert. Alle drei Songs könnten kaum uneuropäischer klingen und sind intimer und bewegender als viele europäische Veröffentlichungen. Sie besitzen einen unbeschreiblichen Charme.
Alles auf „Two Hunters“ klingt lebendig und dicht, gleichzeitig aber auch rau und wild. Der warme, natürliche Sound passt hervorragend zu den außergewöhnlichen Songs und transportiert die tiefe Atmosphäre der Kompositionen perfekt in die heimischen Gefilde. „Two Hunters“ gehört mit seiner erschreckenden Schönheit zu den ergreifendsten und beeindruckendsten Black-Metal-Werken des vergangenen Jahrzehnts und ist bereits jetzt ein Klassiker des USBM!
Montag, 15. August 2011
Party.San Open Air 2011

Das 17. Party.San Open Air war dieses Jahr in gewisser Weise eine Besonderheit. Nach 16 Jahren verließen die Veranstalter das so extrem kultige Gelände im idyllischen Bad Berka und öffneten die Höllentore nun zum ersten Mal in Schlotheim / Flugplatz. Ob dies der richtige Weg ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Viele Fans reagierten 2010, nach dem katastrophalen „Party.Schlamm Open Air“, schockiert auf diese Nachricht. Dass auf dem Party.San Open Air fast immer schlechtes Wetter und viel Regen als zusätzlicher „Headliner“ vertreten sind, sollte nach vielen Jahren bekannt sein.
Am Ende zählt jedoch das Festival als Gesamtpaket, und auch dieses Jahr stellte die Party.San-Crew wieder ein beachtliches Festival auf die Beine – auch wenn wieder einmal nicht alles optimal war.
Die Anreise am Samstag war ungewöhnlich zäh, sodass ich Cliteater verpasste. Angekommen auf dem Gelände, fiel der großflächige Betonuntergrund auf, der sich bei Dauerregen als sehr positiv herausstellte. Zum Glück war das Gelände ähnlich aufgebaut wie in den Jahren zuvor, sodass man sich sofort zurechtfand. Metallschüssel abgestellt, wetterfeste Schuhe übergezogen und ab zur Bühne.
Dort lärmten gerade die hessischen Thrash-Metal-Urgesteine Witchburner, und ich gönnte mir erstmal das erste kalte Köstritzer Schwarzbier. Viel Publikum war noch nicht vor der Bühne, aber bei Panzerchrist füllten sich die vorderen Plätze. Die Dänen konnten mich schon auf ihren Alben „Soul Collector“ und „Room Service“ nicht überzeugen, und ohne Bo Summer von Illdisposed am Mikro wirkte der Gesamtsound noch uninteressanter. Magnus Jørgensen' krächzende Screams passten einfach nicht zu dem böllernden Death Metal der Dänen.
Egal, hingesetzt, Bierchen geschlürft, gequasselt und gelästert bis zur Umbaupause. Was dann allerdings folgte, war schlimmer als ein Samstagabend mit Florian Silbereisen und Stefan Mross zusammen. Heidevolk stümperten auf die Bühne und brachten in 40 Minuten alles auf den Punkt, für was ich mich in der Heavy-Metal-Szene schäme. Pagan Metal in seiner ganzen ekligen Abartigkeit. Wer hört bitte freiwillig solche als Foltermethode getarnte „Musik“? Stampfende Hüpf-Rhythmen, miserabler Klargesang, die Ein-Finger-Keyboard-Technik in Perfektion, peinliches Outfit und magenumdrehende Mitsing-Refrains – 40 Minuten voller Qualen und Fremdscham auf höchstem Niveau.
Warum solche Bands seit einigen Jahren auf dem Party.San Open Air stattfinden, ist mir ein Rätsel. Hier geht es wohl nur darum, mehr Publikum für das Festival zu gewinnen. Anders lässt sich die Menge der „Mallorca-Touristen-Metaller“ auf dem Festival nicht erklären.
Nach dieser Seelen- und Ohrenvergewaltigung freute ich mich auf Exhumed und ihren Carcass-lastigen Grindcore. Doch die Amerikaner waren wohl nach Bad Berka gefahren und suchten dort nach dem Festival, sodass die Norweger Taake ihren Platz mit Exhumed tauschen mussten. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, was an den Norwegern so toll sein soll. Für mich spielten Taake schon immer in der 2. Liga des Black Metal – auch auf dem Party.San. Mittelmäßiger Black Metal ohne Herz und Seele, spannungsarme Songs und ödes Songwriting. Zeit, sich zur Fressmeile zu begeben und beim Inder leckere vegetarische Kost zu genießen.
Exhumed schafften es dann doch noch rechtzeitig nach Schlotheim, um ihren Grindcore in die Massen zu ballern. Nur der Sound spielte wieder nicht mit. Ein einziger Klangmatsch dröhnte aus den Boxen und ließ nur erahnen, wie nah Exhumed am Sound der frühen Carcass sind.
Als Nächstes folgten die gehypten Nachtmystium aus den USA. Auch hier erschloss sich mir nicht, was an ihrem Sound so toll sein soll. Gerade die US-Black-Metal-Szene hat so viele erstklassige Bands zu bieten – Nachtmystium gehören mit Sicherheit nicht dazu. Der immer gleiche, nervtötende Keyboardeffekt war extrem penetrant. Wie man spannenden und intelligenten US-Black-Metal spielt, zeigen Bands wie Cobalt, Woe oder Tomb.
Zeit für Hail of Bullets und den sympathischen Martin Van Drunen. Die Holländer um Ausnahme-Drummer Ed Warby sorgten mit ihrem einfachen und rhythmischen Old-School-Death-Metal für eine angenehme Abwechslung. Teilweise lustige, aber auch dämliche Ansagen von Van Drunen sorgten für den einen oder anderen Lacher. Mehr als mittelmäßiger Standard-Death-Metal bot der Sound der Holländer jedoch nicht, aber die Stimmung war trotzdem beachtlich.
Vielleicht lag dies an der nachfolgenden Band, die von vielen Medien und Fans als die Black-Metal-Band der Stunde angesehen wird: Watain. Doch auch hier folgte für mich nur einschläfernder Black Metal, klischeeüberladen bis zum Gehtnichtmehr! Musikalisch so aufregend wie die Hornhaut am Fuß meiner Oma und so böse wie das Killer-Kaninchen aus Monty Python and the Holy Grail! In den nächsten 45 Minuten war Bier trinken, quatschen und lästern angesagt. Unbedeutsamkeit verdient bei mir keine Beachtung.
Bisher hatte jede Band einen ziemlich miserablen Sound. Die Gitarren waren viel zu leise und drucklos, das Schlagzeug viel zu laut, besonders die extrem getriggerte Bassdrum nervte gewaltig, und der überlaute Bass verschlang jede Melodie. Mit einem super Sound konnte man auf dem Party.San noch nie rechnen, aber was dieses Jahr geboten wurde, grenzte an eine Beleidigung.
Überraschenderweise schaffte man es, der deutschen Death-Metal-Legende Morgoth einen passablen Sound zu verpassen. Eigentlich hatte ich nicht viel von Morgoth erwartet, doch nach wenigen Minuten kristallisierte sich das erste Highlight des Samstags heraus. Zum Glück konzentrierten sich Morgoth auf ihre Werke „Resurrection Absurd“, „The Eternal Fall“ und „Cursed“ und hatten somit genügend erstklassige Songs im Gepäck. Besonders der Band-Klassiker „Pits of Utumno“ sorgte für Gänsehautstimmung. Nur der Gesang von Marc Grewe war etwas zu drucklos, und seine Ansagen wurden auf Dauer peinlich. Trotzdem lieferten Morgoth ein beeindruckendes Set ab.
Nun war es Zeit für den ersten Headliner am Samstag: Enslaved, die sich in den letzten 10 Jahren zu einer der eindrucksvollsten Bands der Extrem-Metal-Szene entwickelt haben. Endlich konnte man von einem fast anständigen Sound sprechen, auch wenn die Gitarre von Arve Isdal etwas zu leise war. Super tight und extrem stimmig beherrschten Enslaved die Bühne. Songs wie „Ground“, „Ruun“, „As Fire Swept Clean the Earth“ und „Isa“ zeigten, warum die Norweger zu den anspruchsvollsten Bands der skandinavischen Szene gehören.
Auch der Klassiker „Allfáðr Oðinn“ reihte sich perfekt in das komplexe Songmaterial ein. Zwar hätte ich mir „Slaget I Skogen Bortenfor“ gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Nur die Nichtbeachtung des Klassikers „Frost“ und das Fehlen von „Eld“ war enttäuschend. Ein Klassiker wie „Svarte Vidder“ oder „Alfablot“ hätte für noch mehr Abwechslung und Stimmung gesorgt. Trotzdem war Enslaved klar die beste Band des Tages.
Der einsetzende Regen und die Müdigkeit zwangen mich, At The Gates zu verpassen.
Bis auf den gewohnt miserablen Sound, Heidevolk und die Running Order war auch das diesjährige Party.San Open Air wieder ein feines Festival. Nur der Charme von Bad Berka fehlte komplett und konnte in Schlotheim nicht eingefangen werden. Die wirklich sparsame Ausschilderung des Festivals war ebenfalls negativ. Gerade bei einem neuen Gelände sollte so etwas nicht passieren. Die nervige Umleitung tat ihr Übriges. Hier hätte man vom Veranstalter mehr Informationen erwarten können.
Die Anzahl der „Touristen-Besucher“ nimmt jedes Jahr zu, was ich sehr schade finde, denn gerade die familiäre Atmosphäre hat das Party.San jahrelang ausgezeichnet. Wenn man sich wieder mehr auf reinen Death Metal, mehr Grindcore und frischen Black Metal aus dem Underground konzentriert, sollten die Pagan-Weicheier und Wacken-Schädlinge fernbleiben. Aber die Party.San-Crew sieht das wahrscheinlich anders. Wenn es nächstes Jahr noch mehr „Folksmusikantenstadl Metal“ gibt, war dies sicherlich mein letzter Party.San-Besuch. Hoffentlich wird es nicht so weit kommen.
Freitag, 5. August 2011
Smorzando - Smrad (Demo)
Wie es sich für ein richtiges Black-Metal-Demo gehört, ist der Sound dementsprechend extrem räudig und stinkt förmlich nach fauligem Keller. Genau hier lässt sich der erste Punkt für die Großartigkeit von Smorzando ausmachen: Der Sound dient auf „Smrad“ sozusagen als ein weiteres Instrument und hebt die ohnehin schon gewaltige Atmosphäre in unglaubliche Dimensionen.
Die Gitarre klingt dermaßen grell und beißend, dass es fast schon Schmerzen bereitet, dabei sind die vielen Melodien so hypnotisch, dass sie im Kontrast zur deprimierenden Grundstimmung stehen. Post-Rock- sowie Ambient-Einflüsse durchziehen die Songs, gepaart mit den irren, psychopathischen Vocals, was eine ganz eigene Grundstimmung erzeugt.
Das Tempo ist größtenteils schleppend und tragend. Keyboardsequenzen sowie der crunchige Gitarrensound schweben auf einer ganz anderen Ebene und besitzen schon fast etwas Magisches. Besonders die irren Vocals sind unglaublich mächtig – allein in „Lied 3“ und „Lied 5“ wird so intensiv geschrien, während in „Lied 2“ das Leiden förmlich spürbar ist. Das ist alles so mächtig und intensiv.
Besonders die grandiose Gitarre in „Lied 3“ zieht mir jedes Mal die Hosen aus, nur um den Song mit einer noch fräsenderen Melodie zu beenden. Intensiver geht es kaum! Die nächste Steigerung folgt mit „Lied 4“. Ehrfürchtige Melodien paaren sich mit psychopathischem Gekreische und einer völlig weltfremden Atmosphäre. Das ist so überwältigend, dass mir die Worte fehlen.
Was Smorzando mit diesem, nüchtern betrachtet, grottigen Demo erschaffen haben, kommt, wenn man Glück hat, nur alle zehn Jahre in der Black-Metal-Szene vor. Hier wird Musik als ausdrucksstarkes Stilmittel verwendet, ohne dabei auf Sound oder spielerische Finesse zu achten. Die Musik auf „Smrad“ würde diese Gefühle niemals so übermitteln, wenn ein professioneller Sound verwendet worden wäre.
Besonders „Lied 5“ würde auf keine andere Weise funktionieren. Wie mächtig kann Musik eigentlich sein? Das unbarmherzige Geschrei, die unwirklich erscheinenden Melodien, die jede Hirnwindung explodieren lassen, und die Klaus Kinski- und Werner Herzog-Samples – sie passen einfach perfekt in den Song. Diese Stimmung kenne ich von keinem anderen Black-Metal-Werk. Die Atmosphäre auf diesem Demo ist völlig einzigartig und etwas ganz Besonderes.
Meine einzige Befürchtung ist, dass Smorzando diese Magie nie wieder reproduzieren können, weder auf einem Album noch auf einem weiteren Demo. Die Hoffnung auf eine weitere Veröffentlichung von Smorzando bleibt dennoch enorm hoch.
Sonntag, 31. Juli 2011
Asphyx - Last One On Earth
Das niederländische Death-Metal-Urgestein und Flaggschiff Asphyx hat mit den frühen Alben einen ganz ureigenen Death-Metal-Sound geschaffen, der – wie ich behaupten kann – ziemlich einzigartig ist (oder war)! Die Band um den charismatischen Martin Van Drunen hat mit diesem 40 Minuten langen Weltuntergang einen bis heute kaum erreichten Klumpen Höllenlava auf die Death-Metal-Welt abgefeuert.
Bereits seit 1987 aktiv, rumpelten sich Asphyx im tiefsten Underground bis Anfang der 1990er Jahre durch zahlreiche Demos, bis man 1990 in Martin Van Drunen von Pestilence den perfekten Prediger des Untergangs fand. Wenige Monate später erschien mit „The Rack“ 1991 der erste Großangriff auf die weltweite Death-Metal-Szene.
Wenn die eingeschworene Death-Metal-Fangemeinde ihre zittrigen Finger nicht nur nach Schweden und Florida ausgestreckt hätte, wäre „The Rack“ mit Sicherheit erfolgreicher gewesen. So blieb dieses frühe Meisterwerk vorerst nur für eine eingefleischte Gruppe im Underground vorbehalten.
Bereits mit diesem Debüt erschufen Asphyx eine Welle der Zerstörung, wie sie von keiner anderen Death-Metal-Band in dieser Form produziert wurde! Ein megabrutaler Gitarrensound vom Ausmaß einer Naturkatastrophe, kreiert von Eric Daniels, ließ die Szene erzittern – und dieser Sound ist bis heute immer noch einzigartig! Brutalster Doom trifft auf eitrig schlurfenden Death Metal, inklusive Pestgestank und Verwesung, der wie ein Strudel alles Leben mitreißt.
Ein Jahr später erschien mit „Last One On Earth“ (1992) der Nachfolger und offenbarte eine Grundstimmung, die bis heute unübertroffen ist. Alles, was auf „The Rack“ offenbart wurde, wurde mit „Last One On Earth“ auf die schon fast unerträgliche Spitze getrieben.
Die trostlose Doom-Endzeitstimmung findet auf „Last One On Earth“ ihren Höhepunkt. Die verklebt-eitrigen Riffs gehören zu den einzigartigsten Erscheinungen im Death Metal, und die alles niederröchelnden Zombielaute von Van Drunen sind bis heute einige der intensivsten Momente in der Geschichte des Death Metal. Mir ist kein weiteres Death-Metal-Album bekannt, das auch nur ansatzweise an die gnadenlose Brutalität von „Last One On Earth“ heranreicht.
Technik, ausgetüfteltes Songwriting und lockere Melodien sucht man hier vergeblich. Doch Erlösung findet man, wenn man sich komplett in der Welt von Asphyx fallen lässt. Eric Daniels' gnadenlose Monster-Riffs tragen das komplette Album und machen 50 % der Faszination von Asphyx aus. Martin Van Drunen röhrt wie ein verschrumpelter Zombie und fräst sich mit seinem Organ durch das meterdicke Riffgebirge, das durch das einfache, aber effektive Schlagzeugspiel von Bob Bagchus zusammengehalten wird.
Konzentrierte Vernichtungsschläge wie „The Krusher“, „Asphyx (Forgotten War)“, „M.S. Bismarck“, „Streams Of Ancient Wisdom“ oder der alles überragende Titelsong (einer der besten Death-Metal-Songs aller Zeiten!) sind bis heute Unikate des Death Metal und wurden in dieser Form, auch von Asphyx selbst, nie wieder erreicht.
„Last One On Earth“ gehört ohne Widerrede zu den 10 stärksten Death-Metal-Alben, die jemals in Europa entstanden sind, und hat von seiner Faszination und Kraft auch heute, nach fast 20 Jahren, nichts verloren. Asphyx erschufen mit diesem Werk ein zeitloses Death-Metal-Dokument, das ohne einen perfekten Sound auskommt (für mich ist dieser wiederum perfekt!). Es besitzt kein anspruchsvolles Songwriting, kreiert jedoch mit den minimalsten Mitteln einen völlig einzigartigen und nie wieder erreichten Sound, der mir auch jetzt, beim Hören der Scheibe, Gänsehaut und Schauer bereitet.
„Last One On Earth“ ist nichts weniger als eines der gnadenlosesten, tödlichsten und brutalsten Death-Metal-Alben, die die gesamte Szene je erleben durfte – und darüber gibt es nichts zu diskutieren!
Freitag, 29. Juli 2011
Dawn - Slaughtersun (Crown of the Triarchy)
1998 erschien mit „Slaughtersun (Crown of the Triarchy)“ ein wahres schwedisches Meisterwerk, das durch einen ähnlichen Mix aus Black- und Death Metal begeisterte wie Dissections „Storm of the Light’s Bane“. Eröffnet wird das Album durch eine schwebende Keyboardsequenz und leise Gitarrentöne, die in typisch schwedische Riffs übergehen, angetrieben von einem druckvollen Schlagzeug.
Bereits der Opener „The Knell And The World“ beeindruckt mit einer gewaltigen Gitarrenwand, bestehend aus kalten Riffs, schwedischen Melodien und einer einzigartigen Harmonie, unterstützt von kraftvollem Schlagzeugspiel und dem herrlich rauen Gesang von Henke Forss.
Die Songs auf „Slaughtersun“ überschreiten alle die 8-Minuten-Grenze und sind allesamt kleine Meisterwerke. In jedem Song passiert so viel, es steckt eine Vielzahl von Details im Songwriting, die Melodieführung ist erstklassig, und auch das Tempo wird spannend variiert.
Man könnte behaupten, dass „Slaughtersun“ ein klarer Dissection-Klon sei. Sicherlich haben sich Dawn an ihren Landsleuten orientiert, doch eine reine Kopie ist dieses Album keineswegs. Die Songs sind im Vergleich zu Dissection deutlich melodischer, schwedischer und etwas gezügelter – das heißt aber nicht, dass die Stücke auf „Slaughtersun“ weniger Energie besitzen!
Gerade das wilde Gekreische von Henke Forss verleiht den Songs eine gewisse Wildheit und gibt ihnen die nötige Black-Metal-Schlagseite. Musikalisch orientieren sich Dawn am frühen Göteborg-Stil, wie ihn At The Gates geformt haben, und würzen diesen mit der melodischen Spielweise des Black Metals von Bands wie Mörk Gryning. Herausgekommen ist eines der besten schwedischen Black/Death-Metal-Alben der 90er, das inzwischen fast zu einem kleinen Klassiker herangewachsen ist.
Keine Band verstand es danach, eine so fantastische Mischung aus schwedischem Death Metal und Black Metal zu kreieren, diese bestimmte Stimmung zu erzeugen oder auch nur annähernd solche Songs zu schreiben wie Dawn auf „Slaughtersun“.
Ein kleiner Kritikpunkt könnte die typische Abyss Studio-Produktion von Peter Tägtgren sein. Eine etwas rohere Produktion hätte dem Songmaterial sicherlich nicht geschadet. Doch der Abyss-Sound auf „Slaughtersun“ ist einer der wenigen, der nicht überproduziert wirkt und die Gitarren schön in den Mittelpunkt rückt.
Besonders bei „The Aphelion Deserts“, meinem persönlichen Highlight auf dem Album, passt der Sound perfekt zu den genialen Gitarrenharmonien und den irren Riffs. Ansonsten gibt es eigentlich keine Sekunde auf „Slaughtersun“, an der man etwas auszusetzen hätte. Hier stimmt alles: kraftvolle und spannende Songs, abwechslungsreiches und druckvolles Drumming, fantastische Gitarrenarbeit, stimmiger Gesang und jede Menge Melodien.
Ob Dawn mit „Slaughtersun (Crown of the Triarchy)“ ein Black-Metal-Album oder eher ein ruppigeres Melodic-Schweden-Death-Metal-Album erschaffen haben, ist mir eigentlich egal. „Slaughtersun (Crown of the Triarchy)“ gehört auf jeden Fall zu den herausragendsten Veröffentlichungen der späten 90er Jahre im Black- und Death-Metal-Bereich!
Samstag, 23. Juli 2011
A Forest Of Stars - Opportunistic Thieves Of Spring
Black Metal aus England war schon immer ein Mauerblümchen, obwohl mit Venom die Urväter des Genres aus diesem Land stammen. Gut, es gibt noch Cradle Of Filth, doch kann man diese nach „Vempire (Or Dark Faerytales In Phallustein)“ nicht mehr dem Black Metal zuordnen. Dann wären da noch Akercocke, die jedoch keinen „reinen“ Black Metal spielen, sowie Hecate Enthroned und der Kirmesverein Bal-Sagoth, die eher für peinliche Momente sorgen. Code hingegen ist keine reinrassige englische Band.
Ein kleiner Lichtblick neben Code und Akercocke waren und sind Grave Miasma, die mit ihrem Necro-Death-Metal den Underground mächtig erschüttern. Aber eine echte Black-Metal-Band im Stil der skandinavischen Szene, der neuen amerikanischen Black-Metal-Welle oder der intellektuellen und spirituellen Szene aus Frankreich hat Mutter England bislang noch nicht hervorgebracht.
Doch irgendwann kommt immer der Wendepunkt, und im Jahr 2010 spuckte die Insel ein Album aus, das in die Galerie der großen monumentalen Kunstwerke der Szene aufgenommen werden muss – Werke wie „Anthems At The Welkin At Dusk“ (Emperor), „OM“ (Negură Bunget), „Dead As Dreams“ (Weakling) und „Fas - Ite, Maledicti, In Ignem Aeternum“ (Deathspell Omega). Dieser perfekt geschliffene Diamant trägt den Namen „Opportunistic Thieves Of Spring“, erschaffen von fünf Künstlern, die es vermögen, Black Metal in die reinste Form von Kunst zu verwandeln. Sie schaffen es sogar, die unantastbare Magie von Negură Bunget's Monument „OM“ einzufangen und diese fast noch intensiver auszuloten.
A Forest Of Stars kamen eigentlich aus dem Nichts. 2007 gegründet, ließen sie bereits 2008 mit „The Corpse of Rebirth“ ein Vorbeben durch die Szene rollen. Doch selbst dieses bereits fabelhafte Kunstwerk ist nur ein laues Lüftchen, das nur Eingeweihte erahnen ließ, dass da etwas ganz Großes unterwegs ist. 2010 erblickte „Opportunistic Thieves Of Spring“ das Licht der immer dunkler werdenden Welt, und seit dem 01.06.2010 steht dieses Werk als Mahnmal im Black Metal – für Bands, die nicht begreifen, dass Black Metal mehr ist als Satan, Hitler, Emo-Quatsch und Hohlbrot-Prahlerei. Black Metal kann musikalisch vielschichtiger, anspruchsvoller, intelligenter und ergreifender sein als jedes andere Genre im Heavy-Metal-Universum!
A Forest Of Stars haben den Black Metal genau da geöffnet, wo er am empfindlichsten ist: beim musikalisch offenen Denken. Was diese Engländer auf „Opportunistic Thieves Of Spring“ verewigt haben, ist nichts weniger als ein vertonter Traum, eine Märchenwelt, in die man gerade in der heutigen Zeit allzu oft eintauchen möchte. Eine Reise in eine fremde Welt, durch dunkle und zugleich wunderschöne Galaxien, die weder schwarz noch weiß sind – die hellen Lichter der Sterne sind zum Greifen nah und doch so weit entfernt.
Für 72 Minuten schaffen es A Forest Of Stars, den Hörer so intensiv gefangen zu nehmen, eine Achterbahnfahrt im Kopf auszulösen, um zu zeigen, was die höchste Form der Kunst, die Musik, alles bewirken kann. Wozu Musik in der Lage ist, wenn man sich ihr völlig hingibt – genauso wie es diese fünf fast überirdisch erscheinenden Künstler auf ihrem Kunstwerk „Opportunistic Thieves Of Spring“ taten. Sie sind eins mit der Musik geworden.
Auf „Opportunistic Thieves Of Spring“ reißt man keine Songs aus dem Gesamtkonzept heraus, um sie zu werten, zu analysieren oder mit anderen Songs zu vergleichen. Ein Werk von Hieronymus Bosch wird auch nicht zerschnitten und jeder Schnipsel einzeln begutachtet – wozu auch, wenn alles perfekt ist? Schon lange hat mich kein Stück Musik mehr so mitgenommen, völlig umschlungen und im Herzen berührt wie „Opportunistic Thieves Of Spring“. Ein fiebrig-psychedelischer Trip in Dimensionen, die nur ganz wenigen musikalischen Werken vorbehalten sind.
Sound, Aufmachung, Image, musikalische Dichte, Songwriting, Gesang und der außergewöhnliche britische Charme – all das hebt dieses Meisterwerk der dunklen Tonkunst in Sphären, die in meiner musikalischen Welt kaum eine Band betreten hat. Das Unmögliche ist eingetreten: England bringt nach Jahren des Schattendaseins im Black Metal eine Band hervor, die es vermag, aus Black Metal und Anspruch eines der mächtigsten Kunstwerke zu formen, die der Black Metal je erlebt hat.
Freitag, 22. Juli 2011
Carcass - Necroticism-Descanting the Insalubrious
Carcass sind eine Legende und zählen neben Napalm Death zu den wohl einflussreichsten Bands für den Grindcore. Die Bedeutung der beiden Alben „Reek Of Putrefaction“ (1988) und „Symphonies Of Sickness“ (1989) lässt sich bis heute nicht abstreiten – ihre Stellung als Klassiker und Wegbereiter im Grindcore ist enorm.
Für viele Fans waren Carcass nach „Symphonies Of Sickness“ bereits „gestorben“, denn den Weg, den die Engländer 1991 mit ihrem Meisterwerk „Necroticism – Descanting The Insalubrious“ einschlugen, ist für viele bis heute unbegreiflich. Doch gerade die Öffnung des starren Grindcore-Sounds auf „Necroticism – Descanting The Insalubrious“ macht dieses Überwerk zu einem der zehn besten Death-Metal-Alben, die jemals in Europa entstanden sind!
Carcass gewannen mit Michael Amott (später Arch Enemy, Carnage) einen der talentiertesten Gitarristen – obwohl er eigentlich Engländer ist – und verschmolzen ihren ureigenen Grindcore-Sound mit melodischen, schwedisch-ähnlichen Gitarrenharmonien und einer deftigen Portion klassischen Death Metal. Herausgekommen ist ein absoluter Meilenstein der europäischen Death-Metal-Geschichte, der bis heute einzigartig und revolutionär ist.
Alle acht Songs sind durchkomponierte Death-Metal-Highlights, die sich durch den typischen, kranken Carcass-Sound von den üblichen Death-Metal-Standards abheben. Grindcore, Death Metal, melodische Gitarrenharmonien, elektrisierende Riffs, massenweise Tempowechsel, Groove und schwedische Melodien werden so geschickt und beispielhaft ineinander verwebt, dass bis heute kein einziges Album auch nur ansatzweise an die ehrfürchtige Klasse von „Necroticism – Descanting The Insalubrious“ herangereicht hat.
Das musikalische Niveau, auf dem Carcass operieren, ist bis heute beängstigend hoch. Jeff Walker's markante „Schweinevocals“ sind bis heute einzigartig und unter Hunderten von Nachahmern sofort zu erkennen. Die musikalische Raffinesse, die Carcass auf „Necroticism – Descanting The Insalubrious“ zelebrieren, hat bis heute Vorbildfunktion, und die schon erwähnte Klasse der Gitarrenarbeit, insbesondere von Michael Amott, ist immer noch State of the Art.
Hier reihen sich Killer-Riffs an Killer-Riffs, ausgetüftelte Harmonien und Soli paaren sich mit treibendem Schlagzeuggroove, und die geschickt platzierten Breaks und Tempowechsel unterstreichen die kompositorische Klasse von Carcass. Auch die kurzen gesprochenen Intros sorgen für eine eigenständige Atmosphäre, und einen ähnlichen Hit wie „Corporal Jigsore Quandary“ besitzen die wenigsten Death-Metal-Bands.
Gerade dieser Song untermauert die Ausnahmestellung von Carcass und ihrem Meisterwerk „Necroticism – Descanting The Insalubrious“. Einen nicht geringen Anteil an der Klasse dieses Albums hat Meister-Produzent Colin Richardson, der hier wohl eine seiner besten Arbeiten ablieferte und Carcass einen unglaublich voluminösen Sound verpasste. Wie lebendig er allein die Gitarren klingen lässt, ist phänomenal. Alle Harmonien und Melodien sind gleichberechtigt neben den Grindausbrüchen in den Sound integriert, ohne erzwungen in den Mittelpunkt gerückt zu werden.
Auch der Drumsound ist wunderbar differenziert und druckvoll. Der gesamte Sound ist meisterlich in Szene gesetzt und passt hervorragend zum durchdachten Songwriting, das Carcass in dieser Form nie wieder erreichen sollten.
Spätestens nach „Necroticism – Descanting The Insalubrious“ stiegen Carcass zu den Top-Acts der weltweiten Death-Metal-Szene auf und gehörten neben Bolt Thrower und den üblichen Verdächtigen aus Schweden zur europäischen Speerspitze! Mit „Heartwork“ folgte 1993 ein zwiespältiges Album, das dem Grindcore und auch dem klassischen Death Metal weitgehend den Rücken kehrte und stattdessen eine Mischung aus melodischem Death Metal und klassischem Heavy Metal präsentierte – zur Verwirrung vieler Fans.
Auch ich kann mit „Heartwork“ nicht viel anfangen, obwohl die musikalische Klasse – wenn man genau hinsieht, ist es das ausgereifteste Carcass-Album – unbestreitbar ist. Dennoch entfernten sich Carcass immer weiter aus der Death-Metal-Szene.
Was bleibt, ist ein zeitloser Klassiker in der Geschichte des Death Metal, der auch heute noch hunderte Bands beeinflusst und in seiner Vollständigkeit bis heute unerreicht ist!
Mittwoch, 20. Juli 2011
Impaled Nazarene - Tol Cormpt Norz Norz Norz...
Wenn es um die großen Black-Metal-Klassiker der 90er geht, führt kein Weg an Impaled Nazarene's Meisterwerk „Tol Cormpt Norz Norz Norz...“ vorbei! Die Finnen um Oberpsychopath Mika Luttinen degradierten 1992 fast die gesamte norwegische Black-Metal-Szene und erschufen mit „Tol Cormpt Norz Norz Norz...“ eines der extremsten Werke des Black Metal.
Auch heute gehört „Tol Cormpt Norz Norz Norz...“ immer noch zu den intensivsten Höllenorgien, die jemals aufgenommen wurden. Nicht nur, dass Impaled Nazarene mit ihrem Debüt eines der fiesesten und besessendsten Black-Metal-Alben aller Zeiten kreierten – die Finnen trieben diesen Sound bis an die Grenze der satanischen Raserei.
Wo es nur geht, wird geprügelt und geschrien, alles verpackt in einem herrlich trockenen Sound und mit einer Besessenheit dargeboten, an der viele Norweger scheiterten. Mika Luttinen's abartiges Organ, sein keifendes Gekrächze und die spitzen Screams gehören auch heute noch zu den wildesten „Gesangsorgien“ der gesamten Black-Metal-Szene und sind völlig einzigartig.
Trotz all des Chaos schaffen es die Finnen immer wieder, leichte Melodien in ihre Songs zu integrieren, und sogar der Groovehammer wird oft bedient. Ob Keyboards, Samples oder irgendwelche Wortfetzen – Impaled Nazarene erschaffen mit ihrem unglaublichen Sound eine bestialische Atmosphäre, die völlig wahnwitzig klingt. Rotzig, punkig, asozial – Impaled Nazarene waren mit diesem Album 1992 ein Unikat in der Szene und zogen viele Neider aus Norwegen auf sich. Die ungezügelte Raserei erreichte kaum eine andere Band aus Norwegen.
Auch mit dem Nachfolger „Ugra-Karma“ von 1993, das ebenfalls ein Klassiker der Black-Metal-Geschichte ist, dominierten Impaled Nazarene weiterhin das Feld und grenzten sich immer mehr von der zweiten Black-Metal-Welle ab. Spätestens aber mit ihrem dritten Album „Suomi Finland Perkele“ (1994) haben sich Impaled Nazarene von einer der bedeutendsten und extremsten Black-Metal-Bands der 90er zu einer Eigenmarke entwickelt.
Auf „Suomi Finland Perkele“ ist nicht mehr viel übrig geblieben von der einstigen schwarzen Raserei – ein gezügeltes Songwriting und vermehrte Melodien beherrschten nun den Sound der Finnen. Auch außerhalb des Undergrounds wurde dieses Album sehr positiv aufgenommen. Für Black-Metal-Puristen war es jedoch das Ende der ersten und bedeutendsten Phase der Band.
„Tol Cormpt Norz Norz Norz...” bleibt für mich neben „Ugra-Karma“ das heftigste Impaled Nazarene-Album. Welchen Einfluss dieses Meisterwerk auf den Black Metal hatte, lässt sich ohnehin nicht bestreiten!
Samstag, 16. Juli 2011
Bestial Warlust - Vengeance War ‘till Death
Bestial Warlust (ehemals Corpse Molestation) gehörten zu den kultigsten Bands aus Australien und stellen gerade in der Black-Metal-Szene eine Ausnahmeerscheinung dar. Mit einem Bastard aus Black- und Death Metal knüppelten sich die fünf Sickos durch sieben bestialische Vernichtungsschläge und lieferten mit ihrem Debüt „Vengeance War 'till Death“ einen Prototyp des heutigen War Black Metal (welch eine dämliche Bezeichnung!).
Angefangen bei dem räudigen Sound, der besonders die sägenden Gitarren und das polternde Drumming hervorragend zur Geltung bringt, bis hin zum wütenden Gebrüll des Sängers Damon Bloodstorm, erschufen Bestial Warlust mit „Vengeance War 'till Death“ einen alles vernichtenden Sturm.
Musikalisch ist das vielleicht keine Offenbarung, aber gemessen an der Energie und Zerstörungskraft gehört „Vengeance War 'till Death“ zu den brutalsten Black/Death-Metal-Alben der 90er Jahre. Auch die norwegische Szene hatte damals nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Bestial Warlust orientierten sich viel mehr am frühen Death Metal und wilden Underground Thrash Metal – Kälte und klirrende Gitarren findet man im Sound von Bestial Warlust überhaupt nicht.
Stattdessen erzeugten die Australier einen barbarischen Feldzug, der so primitiv auf das Nötigste reduziert ist, dass man von einer schier unglaublichen Brutalität erschlagen wird. Wild eingestreute Soli, die eigentlich nur quietschende Gitarrenschrubbereien sind, ein durchweg räudiges, polterndes Drumming und wilde Brüllorgien erzeugen zusammen einen Kriegssound, der auch heute noch genauso brutal und vernichtend klingt wie 1994.
„Vengeance War 'till Death“ gehört bis heute zu den brutalsten Alben, die aus der australischen Szene hervorgingen, und wurde in seiner Radikalität kaum wieder erreicht. Auch wenn Bestial Warlust auf diesem Album keinen reinrassigen Black Metal spielten, haben sie mit ihrem 94er-Debüt einen kleinen Klassiker der Szene erschaffen. Ohne dieses Album würden Bands wie Teitanblood, Proclamation oder Truppensturm sicherlich anders klingen!
Wer allerdings auf Melodien und Ordnung steht, sollte lieber die Finger von Bestial Warlust lassen, denn hier regiert das reine, konzentrierte Chaos!
Disharmonic Orchestra - Not To Be Undimensional Conscious
Neben Pungent Stench gehören Disharmonic Orchestra zu den bekanntesten Death-Metal-Bands aus Österreich. Auf ihrem 1990 erschienenen Debüt mit dem Zungenschnalzernamen „Expositionsprophylaxe“ rumpelten sich die Sickos mit viel Charakter durch ein infernalisches Death-Metal-/Grindcore-Inferno, das heutzutage zu den Klassikern des frühen 90er-Death-Metal gezählt werden darf.
Auch die oberkultige und prägende Split-LP mit Pungent Stench (ebenfalls ein Riesen-Klassiker des Genres!) brachte der Band einen heiligen Kultstatus ein. Richtig musikalisch zur Sache ging es jedoch erst auf dem zweiten und meiner Meinung nach besten Album „Not To Be Undimensional Conscious“.
Während auf dem Vorgänger noch der Grindcore die Überhand hatte, wird man auf „Not To Be Undimensional Conscious“ förmlich mit experimentellem Progressive Death Metal überrascht. Massenweise Breaks, disharmonische Gitarrenläufe, fabelhafte Basslinien und verrückte Songideen werden hier zu einem sehr eigenständigen Gebräu verarbeitet.
Ein cooler Nebeneffekt: Es klingt trotzdem nach typischem 90er-Death-Metal – roh, brutal und mit einem hammergeilen, natürlichen Sound, ohne dabei nach Death (in ihrer musikalischen Hochphase), Atheist oder Cynic zu klingen, was das Songwriting angeht. Auch der völlig eigenständige Charme des Gesamtsounds, der weder typisch europäisch noch typisch amerikanisch klingt, trägt zur großen Klasse des Albums bei.
Auch wenn die Band immer hinter Pungent Stench in der zweiten Reihe stand, waren sie musikalisch um Längen besser als ihre Landsbrüder. Auch gegenüber vielen anderen Death-Metal-Bands dieser Zeit hatten Disharmonic Orchestra im Songwriting einiges voraus.
Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, mir die beiden Nachfolger zu besorgen, obwohl diese musikalisch wohl in eine völlig andere Richtung gehen sollen. Egal – „Not To Be Undimensional Conscious“ sowie das Debüt „Expositionsprophylaxe“ gehören zu den unterschätzten Klassikern der frühen 90er-Death-Metal-Szene und sollten von jedem Death-Metal-Freak wenigstens einmal gehört werden.
Auch wenn die Band sicherlich schon damals ziemlich anders war.